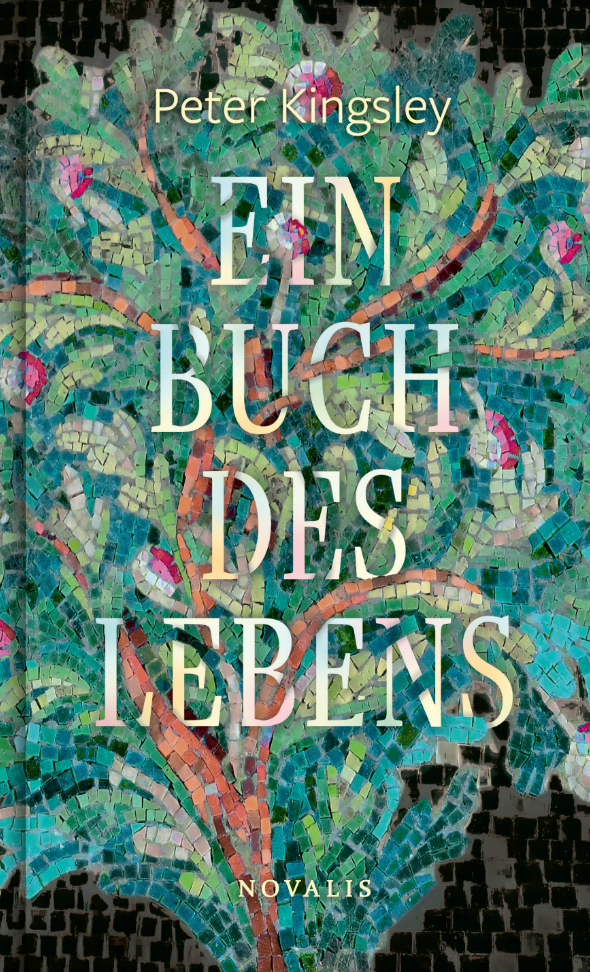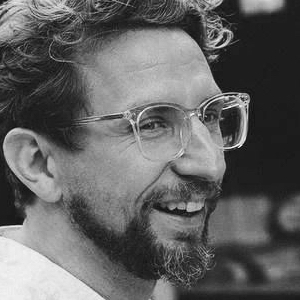Ob in der Liebe, im Beruf, oder in einer Lebenskrise – Ihre Psyche formt Ihre Sicht auf die Welt. Ich begleite Sie mit offenem Geist, um innere Blockaden zu lösen und Klarheit zu schaffen. Ganzheitliche Lösungen entstehen durch individuelle Selbstintegration, nicht durch Standardlösungen. Entdecken Sie meinen Ansatz hier im Interview.
Sie sind als Therapeut tätig, nehmen aber auch Stellung zu aktuellen Fragen der Zeit, wirken als Berater und Mentor. Wie würden Sie sich und Ihre Tätigkeit selbst bezeichnen?
Wie man es in einer Praxis für Psychotherapie erwartet, kommen meine Patienten oder Klienten mit psychischen oder psychosomatischen Beschwerden zu mir, mit Ängsten, emotionalen Belastungen, körperlichem oder seelischem Schmerz. Was ich als Therapeut gelernt habe, lässt sich allerdings auch auf andere Bereiche übertragen. Denn egal, was wir im Leben angehen wollen: wir betrachten die Welt und unsere Wünsche und Ziele immer durch die Brille unserer Psyche.
Wo immer es also hakt im Leben, sei es beruflich oder privat, lohnt sich also ein Blick nach Innen, auf unsere psychischen Strukturen. Wo es uns gelingt, diese zu verändern, ändert sich auch unser Blick auf uns selbst, auf unsere Mitmenschen, unsere Gestaltungsoptionen, kurz: auf die Welt. Es ist eine Begleitung durch die innere Welt, ein Freilegen und Ordnen unserer Emotionen, unserer Antriebskräfte.
Ganz gleich, ob es mir um meine Partnerschaft geht, mein Unternehmen oder meinen Freundeskreis, meine Familie: je klarer ich in mir selbst bin, je aufgeräumter meine innere Struktur, desto bewusster und fokussierter kann ich mein Leben gestalten. Insofern könnte ich mich auch als Mentor für Lebensgestaltung und Unternehmensführung bezeichnen. Ich begleite Selbstbegegnungsprozesse, wende die Einsichten der Psychotraumatherapie auf alle Lebensbereiche an. Letztlich geht es um Selbstermächtigung.
Wie sind Sie zu Ihrer Tätigkeit gekommen?
Eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Richtung, habe Design studiert und in der Medienbranche gearbeitet. Auf der anderen Seite war es immer ein Anliegen von mir, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu stärken. Für die Bahaigemeinde habe ich Trauerfeiern gestaltet, als Zivi Behinderte und Sterbende begleitet.
Als Kommunikationsdesigner lag unter der Frage der passenden Gestaltung auch immer die Frage nach dem Gegenstand der Gestaltung, also: Wer bist du? Was treibt dich an? Wem oder welchen Zielen dienst du? Da war der Weg zur Psychotherapie nicht mehr weit.
Mein Einstieg in die therapeutische Arbeit war die Aufstellungsarbeit. Dazu kamen verschiedene psychotraumatologische und körperorientierte Ansätze. Heute verbinde ich das alles in meiner Praxis für Aufstellungsarbeit und Traumatherapie.

Heraklits Aphorismus „alles fließt“ bildet die Grundlage des Pantarei-Ansatzes: Wo Spannungen sich lösen, kann innere Annahme und Integration geschehen.
Besonders faszinierend finde ich die Verknüpfung somatischer Ansätze wie Pantarei – womit ich innere und äußere Beziehungen durch sanfte Berührung und Achtsamkeit vertiefe – mit resonanzbasierten Ansätzen wie der systemischen Aufstellungsarbeit nach Mahr – mit der verborgene Dynamiken sichtbar werden – sowie der Identitätsorientierten Psychotrauma-Theorie und -Therapie (IoPT) nach Ruppert, ergänzt durch Michaela Hubers Arbeit mit Identitätsspaltungen. Alle diese Stränge verbinde ich zu einem kohärenten Ganzen, das den Klienten hilft, Fragmentiertes zu integrieren und wieder ganz zu werden.
Gibt es unverrückbare Grundsätze Ihres Denkens und Ihrer Arbeit? Welche wären das?
Das ist eine spannende Frage! Denn ganz spontan würde ich erstmal antworten, dass in meiner Arbeit nichts unverrückbar ist. Ganz im Gegenteil! Was meine Arbeit auszeichnet, ist eine Grundhaltung des Nicht-Wissens. Ich biete meinen Klienten einen Raum, um mit sich selbst, ihren inneren Anteilen, in Resonanz zu gehen, bin also vor allem Beobachter und Begleiter in einem Prozess der Selbsterforschung und Selbstintegration.
Also, um auf die Frage zurückzukommen: Wenn es einen unverrückbaren Grundsatz meiner Arbeit gibt, dann den, dass ich die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit meines Gegenübers in den Mittelpunkt stelle, ihm den Raum gebe, seinen Prozess der Selbstbegegnung und Traumaintegration selbst zu steuern, die Regie des eigenen Films zu übernehmen, ganz gleich, ob dieser die eigene Innenwelt, die Herkunftsfamilie oder andere externe Systeme behandelt. Wohin die Reise geht, zeigt sich im Resonanzraum meiner Klienten innerhalb des von ihnen gesetzten Anliegens. Mein wichtigster Grundsatz in der Begleitung ist, isolierte Fragmente zur Verbindung einzuladen, Abgespaltenes und Verdrängtes zu integrieren, kurz gesagt: aus der Angst zur Akzeptanz zu kommen.
Welche Bedürfnisse haben die Menschen, die Ihre Hilfe suchen, vor allem?
Die Menschen, die meine Hilfe suchen, wollen Blockaden in ihrem Leben lösen, wollen sich selbst, ihr Unternehmen, ihre Partnerschaft, ihre Familie besser verstehen. Sie suchen einfache Lösungen und finden sie – viel näher als gedacht – in sich selbst. Sie haben das Bedürfnis, gesehen zu werden, verstanden und gehalten zu werden, oftmals weil sie sich selbst nicht mehr verstehen, ihren Halt im Leben verloren haben.
Worin sehen Sie Ursachen für die gesellschaftliche Krise und wie wäre ihr am besten zu begegnen?
Besteht denn Einigkeit darin, worin die gesellschaftliche Krise besteht? Wie kann ich Ursachen ausmachen, wo ich mir gar nicht im Klaren über das Krankheitsbild bin? Wen fragen wir denn? Politiker würden vielleicht von einer Vertrauenskrise sprechen. Der Bürger hingegen sieht wahrscheinlich in der Politik das Problem. Was auffällt: das Problem sind immer die anderen. Hier setze ich an und sage: Schau erst mal auf dich selbst und räume dein Inneres auf. Und dann schauen wir uns alles nochmals an! Viele sprechen derzeit von kollektiver Heilung. Doch der Weg geht von innen nach außen. Muss ich denn die Ursache einer Krise kennen, um sie zu lösen? Ich weiß es nicht.
Aber ich will nicht ausweichen. Die Grundlage für eine gesunde Gesellschaft ist die gesunde Psyche ihrer Bürger. Und diese wird angelegt durch gesunde Bindungsmuster in den ersten Lebensjahren. Hier gibt es viel zu tun. Das beginnt während der Schwangerschaft, betrifft die Geburt, das ganze erste Lebensjahr. Nur wer sich von Anfang an willkommen, beschützt und geliebt fühlt (Rupperts Trauma-Trias), entwickelt eine gesunde Resilienz. Das bestätigen Bindungsforscher wie Karl-Heinz Brisch. Die symbiotische Verbindung des Säuglings zu seiner Mutter bildet die Grundlage für die spätere Autonomie. Ich würde so weit gehen, zu sagen: Frühe Bindung ist die Basis eines mündigen und souveränen Bürgers, ohne den unsere Gesellschaft nicht funktionieren kann. Wer nicht sicher gebunden ist, entfremdet sich von sich selbst. Dazu kommt die Entfremdung von der Natur. Die Entfremdung von unseren spirituellen Quellen. Digitale Sucht. Fremdbestimmung. KI. Reicht das?
Ein entscheidender Faktor scheint mir übrigens das Vakuum zu sein, das der Verlust unseres christlichen Erbes hinterlassen hat. Der Glaube an einen allmächtigen Gott, einen Gott der Vollendung und Perfektion, aber auch der Strafe, ist tief in unsere kulturelle DNA eingeschrieben. Jetzt, wo dieser Glaube weggebrochen ist, haben wir selbst das unbewusste Bestreben, den Platz einzunehmen, den diese Lücke hinterlässt. Das führt zu einem Machbarkeits- und Kontrollwahn, zu einer Selbstüberschätzung, die im Zeitalter von Nano- und Biotechnologie brandgefährlich ist. Es führt aber auch zu einem neuen Moralismus. Wo Gott nicht mehr richtet, fühlt sich nun der Mensch dazu berufen – notfalls auch mit unlauteren Mitteln, die dann gerechtfertigt erscheinen, wenn man sich moralisch überlegen fühlt. Mein Kollege Malte Nelles beschreibt das ganz gut in seinem Buch Gottes Umzug ins Ich. Mit Spannung habe ich auch den Philosophen und Historiker Peter Kingsley gelesen, der davon ausgeht, dass wir gerade am Ende einer geistigen Epoche stehen.
Was sind die wichtigsten Herausforderungen oder Probleme, die Ihre Klienten haben und wie helfen Sie ihnen dabei, diese zu lösen?
Die größte Herausforderung meiner Klienten ist, ihren eigenen Gefühlen Raum zu geben. Nur wer negative Emotionen nicht wegdrückt, wird auch wieder Freude und Zuversicht spüren können. Ohne Wut keine gesunden Grenzen. Ohne Schmerz keine Heilung. Ohne Traurigkeit keine Freude. Ohne Abschied und Trauer kein Neuanfang! Je mehr ich mir selbst erlaube, mit all dem da zu sein, was in mir ist, desto leichter fällt es meinem Gegenüber, es mir gleich zu tun. Hier geschieht Heilung, hier geschieht Transformation; das gilt im Kleinen wie im Großen, im Innen wie im Außen.
Das heißt, je mehr ich lerne, all meinen Facetten einen Platz einzuräumen, keine mehr zu verurteilen, sie alle anzunehmen und in einen konstruktiven inneren Dialog zu bringen, desto leichter wird es mir fallen, auch nach Außen hin Toleranz zu zeigen, andere Meinungen zu tolerieren, allem und jedem einen Platz einräumen zu können, die Welt mit klarem Auge zu sehen, sie friedlich zu gestalten statt sie zu bekämpfen. Wie also helfe ich dabei? Indem ich da bin. Zeige, dass meine eigenen Traumata mich nicht verbittert haben, obwohl ich allen Grund dazu gehabt hätte. Das hat auch etwas mit einem gesunden Maß an Demut zu tun.
Was sind die häufigsten Mythen über Ihr Fachgebiet?
Meine Praxis ist keine Werkstatt, keine chirurgische Ambulanz – der Mensch keine Maschine, die man einfach reparieren kann. Seelische Störungen und Blockaden sind nicht von außen mechanisch zu lösen. Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel können keine dauerhafte Erleichterung bringen, wenn die Psyche gespalten ist und den Genesungsprozess sabotiert. Es geht auch nicht nur darum, sich und seine eigene Psyche zu verstehen, so wichtig das auch ist als erster Schritt. Heilung ist viel mehr als das: emotionale Integration und Verbundenheit mit der eigenen Seele. Wir sind komplexe, transzendente Wesen, die in Beziehung zu anderen und zur Welt stehen. Alles das will berücksichtigt sein.
Neben diesen Missverständnissen, welche den Menschen viel kleiner machen als er ist, sehe ich den größten Mythos allerdings darin, zu glauben, dass unsere Gesellschaft psychisch gesund sei, während jene, die meine Praxis besuchen, als krank bezeichnet werden. Ich sehe das genau andersherum: Wer Teil eines kranken Systems ist, sich in dieses eingefügt hat, muss früher oder später selbst krank werden. Um aus unbewussten Täter-Opfer-Dynamiken auszusteigen, muss ich zunächst einen Schritt aus jenen Systemen heraus wagen, welche von diesen Dynamiken leben. Eine sogenannte psychische Störung kann so gesehen ein erster Schritt in Richtung Heilung sein. Was als Problem erscheint, weil es das System stört, ist oftmals ein erster Moment individueller Selbstbehauptung, heraus aus der Entfremdung von sich selbst.
Autoren wie Erich Fromm und Arno Gruen – Pioniere der Kritik an der sogenannten Pathologie der Normalität – haben das entlarvt, ebenso Hans-Joachim Maaz oder Gabor Maté: Die vermeintliche Krankheit ist kein Makel, sondern der Funke der Rebellion gegen ein System, das uns von unserer Essenz trennt. Sie laden ein, diesen Moment nicht zu pathologisieren, sondern als Aufruf zur Selbstbefreiung zu hören.
Was empfehlen Sie Ihren Klienten auf dem Weg zu sich selbst? Welche Ratschläge geben Sie?
Ich rate meinen Klienten zweierlei: Zum einen, ihre Traumabiografie aufzuarbeiten, verdrängte Ich-Anteile und Traumagefühle zu integrieren. Hier geht es für mich letztlich um das, was Carl Jung als Individuation bezeichnet hat. Zum anderen rate ich – und das mag vielleicht zunächst verwundern – sich mit dem Leben nach dem Tod zu befassen. Neben der Aufarbeitung der Vergangenheit hilft auch ein Blick ins Ewige, um Präsenz zu gewinnen. Das ist für mich weitaus mehr, als die Konfrontation mit unserer körperlichen Vergänglichkeit. Es ist eine Verbindung und Stärkung mit dem Ewigen in uns, eine Auseinandersetzung mit der Frage, was von uns bleibt über den Tod hinaus. Wenn wir es einzuüben lernen, uns damit zu verbinden, finden wir uns selbst. Letztlich geht es darum, unser Leben zu leben. Therapie darf keine Selbstoptimierung um ihrer selbst willen werden, kein Lebensersatz.
Was sind einige der häufigsten Fehler oder Fallstricke, die Sie in Ihrer Arbeit gemacht oder gesehen haben und wie haben Sie daraus gelernt?
Was ich als Therapeut und Prozessbegleiter zunächst lernen musste, ist, dass ich meine eigene Geschichte, meine eigenen Themen, meine Traumata, nicht auf meine Klienten projiziere. Es gibt eine Gefahr, in seinem Gegenüber das zu sehen, was man von sich selbst kennt, und womöglich eigene Überlebensstrategien als das Rettende zu verkaufen. Doch wenn ich wirklich helfen will, bin ich nicht mehr als ein Begleiter in der Selbsterforschung und Selbstintegration meines Klienten. Meine Aufgabe ist es, die Konfrontation mit den eigenen Ängsten zu begleiten und meinen Klienten dabei zu unterstützen, seine innere Ordnung wiederzufinden.
Was ist das Erfüllendste an Ihrer Arbeit?
Es ist immer wieder ein erhebendes Gefühl, wenn jemand aus meiner Praxis mit mehr innerem Frieden, mehr Gelassenheit und mehr Zuversicht nach Hause geht. Oft sind die Schritte sehr klein, subtile Feinjustierungen, die für die Betroffenen aber einen großen Unterschied machen können.
Herzlichen Dank.
Die Fragen dieses Interviews stammen von Gunnar Kaiser (1976–2023), dem Philosophen, Autor und kritischen Publizisten. Kurz vor seinem Tod am 12. Oktober 2023 plante er ein Gespräch mit mir, das leider nicht mehr zustande kam. Zwei Jahre später beantworte ich sie hier, inspiriert von seinem Mut zu unabhängigem Denken und seiner stoischen Haltung gegenüber pauschaler Kritik. Sein Geist lebt in der Suche nach Wahrheit fort – und bereichert so diesen Blick in meine Arbeit.